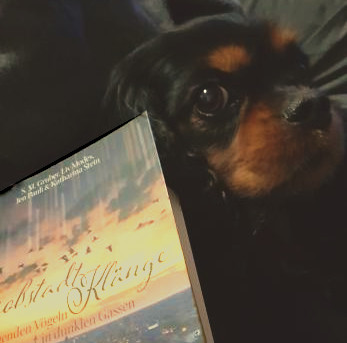Kann man ein Buch mögen, sehr gern gelesen haben – wenn man die Hauptfigur nicht ausstehen kann?
Ja, geht, wenn es Krien ist.
Ich mag den Sound, das Klare der Prosa, die kühlen Sätze, das Kurze, das Tempo. Kriens Erzählton ist (wieder) ganz meins. Und ich mag: die Konzentration auf das ‚kleine Leben‘. Alltägliche Menschen, alltägliche Probleme – keine großen Schlachten werden geschlagen, es dreht sich um den Mikrokosmos Familie, Beziehung, Liebe, Arbeit, Alltag im Hier und Jetzt.
Das wird Krien oft vorgehalten, diese kleinen Themen – aber ich bin da ganz Kabbala: Das Große ist im Kleinen und das Kleine ist im Großen.
Also, ein tolles Buch. Fertig. Kurzrezension Ende.
Naaa, nee, ne. Denn, wie gesagt, ich kann die Hauptfigur nicht ausstehen. (Und ihren Mann genauso wenig). Dieses Pärchen um die Fünzig – Bildungsbürgertum, er Prof., sie Thera. Dazu zwei gesunde, erwachsene Kinder. Urlaubsfindungsprobleme und Beziehungsprobleme und Lebensende-nähert-sich-Probleme und: kein Bock mehr.
Das wäre der Titel überhaupt: Kein Bock mehr.
Also, der Peter auf die Rahel. Denn er schläft nicht mehr mit ihr, mit dieser schönen Frau, die sich so sehr danach sehnt, begehrt zu werden.
Aber das war es noch nicht, man hat nämlich: Keinen Bock mehr auf das Aushandeln, Austarieren von Beziehungen – auf Widerspruch, Kritik oder stetiges Neu-Kennen-Lernen. Keinen Bock mehr auf den Job – er ist gekränkt, weil seine Lehrmethoden von den neuen Studenten nicht geschätzt werden, ihr gehen die Patienten auf die Nerven. Man hat auch keinen Bock auf die Enkel und schon gar nicht auf neue Erziehungsmaßstäbe, wo dann u.U. unterm Tisch gegessen wird.
Keinen Bock auf die Fragen, die die Kinder aufwerfen – die Tochter ganz direkt, indem sie die Klappe aufreißt und ihre Ehe sehenden Auges an die Wand fährt. Der Bub, indem er zu Armee geht.
Zur Armee. Ausgerechnet. Man nimmt es bisschen mit ‚Er liebt halt Sport und Adrenalin, kann sich da ausleben‘, doch dann kommt er damit, dass er die Freiheit verteidigen will. Dass er es ernst meint: Soldat sein. Und auch da hat man keinen Bock auf Diskussion, ist so ein schöner Sommerabend, man sieht sich nicht oft …
Gleich zu Beginn findet Rahel Tabak, dreht sich eine Zigarette und kommt stetig nicht dazu, sie zu rauchen. Weil immer was ist und immer wer was will und immer … ich gebe offen zu, dass ich im letzten Drittel das Buch angeschrien habe: „Du bist fünzig, Mädel. Wenn du eine rauchen willst, dann rauch eine. Verdammte Axt.“
Sie raucht sie noch, aber das hätte sie sich schenken können. Keinen Bock auf Schmutz in der Wohnung, auf jede Art der Veränderung, keinen Bock auf Nachrichten (Klimawandel, ganz schlimm, ganz schlimm, gleich mal Radio ausmachen) – keinen Bock auf Menschen, die anders denken, leben, handeln, keinen Bock auf Streiten und schon gar keinen Bock auf die Pandemie. ‚Man kann ja nicht in Furcht leben‘. Bloß weil da ein Virus rumseucht, kann man jetzt nicht irgendwas ändern, wo kommen wir denn da hin? Der drohenden Unbill des Alters und dem potentiellen Verlust von Körperfunktionen wird mit einer Patientenverfügung begegnet – alles abschalten, fertig.
Die Erwartung aneinander ist, dass der andere ein stetig verfügbares Lager ist, auf das man sich, wann immer man es braucht, sanft betten kann – und bitte, also wirklich, bitte keine Erbsen unterm Laken aus ägyptischer Baumwolle. Da hat man – richtig – keinen Bock mehr drauf. Und genauso geht man miteinander um, ein einziger Eiertanz um jedes echte Gefühl. Harmonisch wird gekocht und geschwommen und irgendwann auch wieder geliebt.
Kein Einlassen aufeinander, nirgends. Peter, der seine Zuneigung zu den Tieren entdeckt (oder ist es Rahel, die hier entdeckt, dass ihr Peter Tiere mag?) und damit allein bleibt. Rahel nimmt es wahr und das war es. Nicht ein einziges Mal wird die Katze gestreichelt oder das Pferd getätschelt. Und selbst der flugbehinderte Storch (Ein Storch! – würde ausrasten, aber naja) ist für Rahel nur Szenenhintergrund für ihren Peter, der ja doch noch ganz fesch ist, für sein Alter.
Kein Bock auf Trennung – aber nicht etwa, weil man noch ein Interesse am ‚Wir‘ hätte – sondern weil so eine Trennung ja auch nur Mühe macht. Trennungsarbeit ist Beziehungsarbeit und dann muss man noch die Möbel umstellen, ach, kein Bock.
Peter schlägt Rahel vor, sie könne sich ja einen Mann dazu nehmen, das sei in Ordnung für ihn. Jetzt. Rahel lehnt ab, aber sanft, ganz sanft. Ohne ihn zu verletzen, ohne Diskussion, ohne irgendwas auf den Tisch zu bringen – und das ist eine der unzähligen Szenen, in denen man sich wünscht, Rahel würde ganz entspannt nach dem Kissen greifen und ihre yogagestählten Körperkräfte nutzen, um den Alten einfach zu ersticken.
Als Rahel endlich, ENDLICH der Faden reißt und sie ihre ganze Wut auskotzt – zack, gleich darauf: „Verzeih, verzeih, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist …“ *wirft sich in den Staub und rollt dreimal*
Und Peter: „Ja, geht mir genauso. Glaub, du kennst mich gar nicht. Aber naja. Bin jetzt mal beim Pferd. Machst du Salat zum Abendessen, Schatz? Einen, der zum Riesling passt?“
Natürlich ist das falsch zitiert, reduziert und völlig überspitzt. Krien ist eine feine Autorin, eine subtile Beobachterin und sie malt ein Sittengemälde, genau, bittergenau und alles daran ist wahr und alles daran kennt man (auch von sich selbst). Ich lese es als Zeitzeugnis, als exakte Beschreibung ohne Zynismus und ohne Gnade. Es legt frei – und überlasst es vollständig dem Leser, wie er dazu steht. Nein, ich habe keine Ahnung, welchen Blick die Autorin selbst auf ihr Paar hat – und das ist große Kunst.
Erzählen, ohne die Wertung beizulegen. Das macht für mich einen Großteil dessen aus, warum ich dieses Buch sehr gern gelesen habe und es wieder lesen werde – auch wenn ich hier zetere.
Was mich langfristig mehr beschäftigt als das Gekusche voreinander, ist der herabsetzende Blick Rahels auf die ‚jungen Menschen‘ – besonders auf ihre Patienten.
Ihre Großmutter, ja die, die ist mit nackten Füßen durch das brennende Dresden gerannt – das war noch ein anständiges Trauma! Aber Kifferpsychosen, Notkaiserschnitte und verwöhnte Jungmänner, die erkennen, dass sie doch keine kleinen Prinzen sind? Pah. Wunsch und Wirklichkeit, sagt sie, bekommen die nicht übereinander. Das war’s.
Das war es nicht. Es gibt keine leichten Zeiten und es gibt keine Hierarchie im Leid. Zu glauben, es gäbe keinen Hunger an reich gedeckten Tischen, ist ignorant. Aber das wäre ein eigenes Buch, wollte man davon erzählen …
Ein erschreckendes, schreckliches Buch – nicht zuletzt, weil die Protagonisten nur unwesentlich älter sind als ich. Vielleicht sollte ich eine rauchen, nur aus Prinzip.