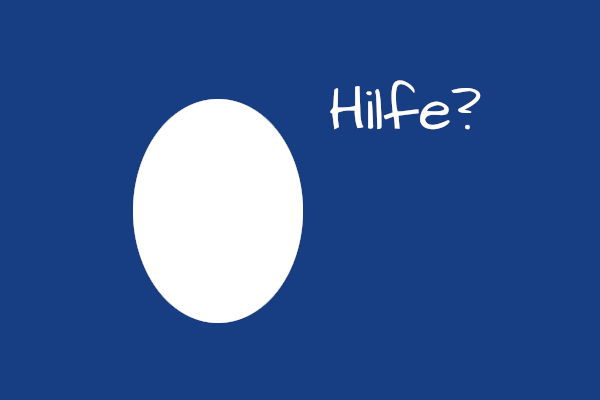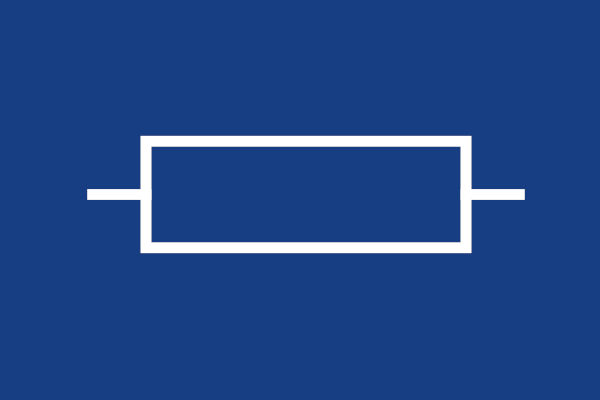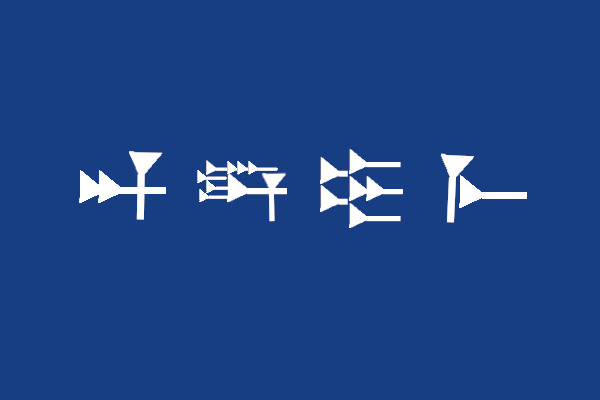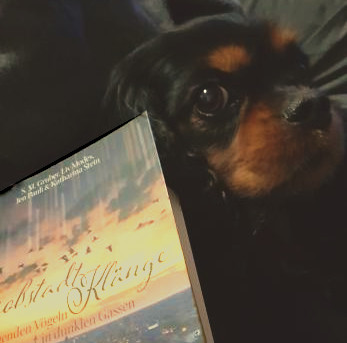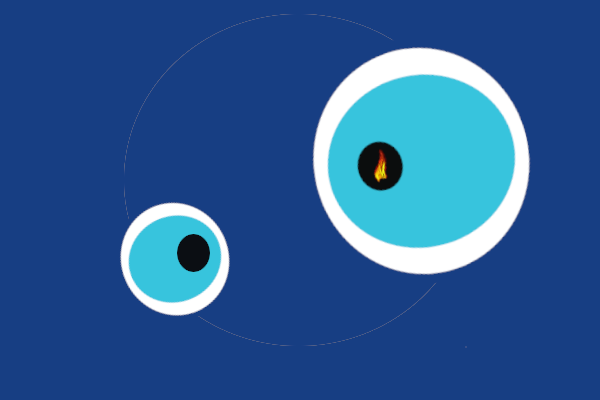Es war der 22. Dezember. Humphrey, Versandwichtel Stufe eins, Kernbereich Europa, lehnte sich zufrieden zurück. Alles lief bestens. Dem 15%igen Anstieg der Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr waren sie dank seines Optimierungsprogramms mit Leichtigkeit gewachsen.
Gut, seit Mitte November hatte der Weihnachtsmann schlechte Laune. Humphrey hatte ihn auf Diät gesetzt. Schon zweimal hatte es erhebliche Verspätungen bei den Geschenklieferungen gegeben, weil der Weihnachtsmann im Kamin stecken geblieben war. Diesmal nicht, dafür würde Humphrey sorgen.
Auch das Christkind war beleidigt. Humphrey hatte sein Kontingent an Glitzerstaub halbiert. Kostengründe.
Sein größter Coup aber war der Einsatz von E 1563. Einem Pulver, das Spielzeuge lebendig machte, so dass sie sich selbst verpacken konnten. Sehr effektiv und personalsparend.
Wie gesagt, alles lief bestens. Bis, ja bis der Aushilfswichtel Ferdinand, zerstreut wie er war, nicht E 1563 auf ein Einhorn sondern ein Einhorn in das E 1563 warf.
„Oh, also ich finde es wirklich toll hier. Alles so bunt. Aber bisschen hektisch ist es schon, nicht? Kann ich von den Keksen haben? Ja? Die sind aber nicht mit Butter, oder? Margarine ist viel gesünder!“, hörte Humphrey, als er die Versandabteilung betrat. Seit zwei Stunden nervte das Einhorn die Mitarbeiter.
„Noch keine Anzeichen, dass die Wirkung nachlässt?“, fragte Humphrey seinen besten Mann. Der schüttelte nur den Kopf und wandte sich seiner Arbeit zu.
Humphrey verdrehte die Augen. Die Tests zur Langzeitwirkung hatte er eingespart, nun blieb ihm nichts anderes übrig als abzuwarten.
„Komm mit“, sagte er zu dem Einhorn.
„Wohin denn? Weißt du, ich hab es mir hier gerade gemütlich gemacht und wenn jetzt nichts wirklich wichtiges vorliegt, dann würde ich …“
„KOMM JETZT MIT!“
„Ist ja gut. Meine Güte, man wird doch in Ruhe seinen Keks aufessen dürfen. Habt ihr Termindruck oder was?“
Humphrey brummte vor sich hin. Der Weihnachtsmann durfte auf gar keinen Fall etwas mitbekommen. Seit Humphrey ihm die Lebkuchen mit Kirschfüllung gestrichen hatte, wartete der nur darauf, ihn seines Amtes zu entheben.
„Hach, ist das schön hier“, plapperte das Einhorn neben ihm, „all die Bäumchen und die Kugeln und die Kerzen. Vielleicht ein bisschen überfrachtet, ich mag ja lieber klare Raumkonzepte. Du weißt schon. Linien und Leere.“
„Es ist Weihnachten“, sagte Humphrey, „das nennt sich Tradition.“
„Ach …“, begann das Einhorn, wurde aber vom Christkind unterbrochen.
Das kam gerade um die Ecke, Lockenwickler im Haar, und rief Humphrey zu, es brauche unbedingt mehr Glitzerstaub, ohne Glitzerstaub sei …
„Noch mehr Glitzer?“, fragte das Einhorn. „Na ich weiß nicht. In deinem Alter sollte man mit Make Up zurückhaltender sein.“
Das Christkind wechselte von engelsporzellanfarben auf dunkelrot. „Eines sag ich dir“, zischte es Humphrey zu, „das Vieh überbringe ich nicht!“
„Wie überbringen?“, fragte das Einhorn, unbeeindruckt von dem wütend davon rauschenden Christkind.
„Du bist ein Geschenk“, erklärte Humphrey, „ein Spielzeug für ein braves, kleines Mädchen.“
„Geschenk? Geschenk! Für ein Mädchen! Hör mal, wir Einhörner sind edle Wesen. Reittiere großer Männer! Alexander der Große hatte eines und Lanzelot auch. Das hat mit dem Horn seine Feinde aufgespießt.“
„Meine Güte, vielleicht hat das Mädchen ja einen kleinen Bruder, den du aufspießen kannst“, stöhnte Humphrey.
Am nächsten Morgen war das Einhorn noch immer quicklebendig und redete ununterbrochen.
„Weißt du eigentlich, was kleine Mädchen tun? Sie flechten Zöpfe in die Mähne und stecken rosa Spängchen rein. Oder ziehen dir Kleidchen an. Oder sabbern auf dich drauf, während sie schlafen. Das ist entwürdigend.“
„Du wirst verschenkt“, sagte Humphrey, „Basta.“
„Nein“, sagte das Einhorn. „Ich wende mich an die Gewerkschaft.“
„Die habe ich eingespart“, erklärte Humphrey und holte sich einen extra starken Kakao mit doppelt Marshmallow.
Ein Ersatzeinhorn zu fertigen war aufgrund seiner perfekten Kalkulation der Arbeitsmaterialien undenkbar. Es sei denn, sie hätten eines aus den Wollresten der Sockenabteilung gemacht. Aber dann hätte sich das Kind sicher beim Weihnachtsmann beschwert. Öko war nicht im Trend. Auf dem Wunschzettel hatte ganz klar „Rosa Einhorn mit funkelnder Mähne“ gestanden.
Blieben die Rentiere. Vielleicht würden die sich bereit erklären, die Nervensäge zu schmuggeln.
Aber sie hatten schon von dem Einhorn gehört und weigerten sich beharrlich. Vielleicht hätte Humphrey sie nicht zu dem Extra-Fitness-Programm zwingen sollen, das er entwickelt hatte, um die Schlittengeschwindigkeit um 7,35 % zu erhöhen.
Es blieb ihm nicht anders übrig. Er musste es selbst tun. Der Sandmann schuldete ihm noch einen Gefallen.
An Heiligabend setzte der Sandmann Humphrey und das Einhorn auf dem Dach des Hauses ab, in dem das kleine Mädchen wohnte.
„So“, sagte Humphrey, „ab durch den Kamin.“
„Nö“, sagte das Einhorn.
„Doch“, sagte Humphrey.
„Meinst du nicht, es könnte dem Mädchen auffallen, dass ich lebendig bin?“
Daran hatte Humphrey nicht gedacht. Er hatte im Stress vollkommen vergessen, dass Menschen äußert pingelig bei solchen Kleinigkeiten waren. Rosa Einhorn war eben nicht gleich rosa Einhorn.
„Mist“, sagte Humphrey.
„Aber hey, das ist doch toll. Ich könnte zu dir ziehen, weißt du, so als WG. Das wird bestimmt nett. Natürlich müssten wir dein Zimmer dann ein wenig umgestalten. Stilvoll, wenn du verstehst was ich …“
„Ich hab’s“, sagte Humphrey.
Zehn Minuten später warf der Wichtel, begleitet von dem zeternden Einhorn, die Scheibe eines Spielzeugladens ein. ‘Made in China’ stand auf dem Zettel mit den Waschhinweisen am Hinterteil des Plüschtiers, aber das war egal. Hauptsache Rosa und Funkeln.
Der erste Weihnachtsfeiertag begann friedlich. An das Geplapper des Einhorns hatte sich Humphrey inzwischen gewöhnt und irgendwann musste die Wirkung des E 1563 wieder nachlassen. Hoffte er.
Etwas mulmig wurde ihm allerdings, als das Christkind und der Weihnachtsmann breit grinsend auf ihn zu kamen und ihm eine Zeitung hinhielten.
Die Schlagzeile lautete:
Sehr kleiner Mann bricht am Heiligabend in Begleitung einer Ziege in ein Spielzeuggeschäft ein.
Humphrey wollte gerade zur einer Erklärung ansetzen, doch das Einhorn vermasselte wieder alles.
„Ziege?“, schrie es. „ZIEGE!“ Dann brach es zusammen.
„Lasst mich raten“, sagte Humphrey, „ihr versetzt mich in die Außenstelle. Kernbereich mythische Huftiere.“
Der Weihnachtsmann zog einen Lebkuchen mit doppelter Schokoladenglasur aus der Manteltasche und nickte.